Privatanteil im Unternehmen: Was steuerlich gilt (Österreich)
- Michael Leister
- Aktualisiert:
- Unternehmensratgeber
- Buchhaltung & Steuern

Viele Unternehmer nutzen betriebliche Geräte und Leistungen auch privat – etwa das Smartphone, den Internetanschluss oder den Firmenwagen. Wird etwas nicht ausschließlich betrieblich verwendet, liegt ein sogenannter Privatanteil vor. Dieser darf steuerlich nicht als Betriebsausgabe angesetzt werden und muss anteilig privat getragen werden – sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer.
Typische Beispiele für den Privatanteil
Bestimmte betriebliche Anschaffungen werden häufig auch privat genutzt. In solchen Fällen ist ein Privatanteil steuerlich zu berücksichtigen, da nur der betriebliche Nutzungsanteil als Betriebsausgabe anerkannt wird.
Typische Fälle sind:
- Smartphone
- Internetanschluss
- Firmenauto: Details im Abschnitt Privatanteil beim Firmenauto.
- Büroausstattung: Laptop, Drucker, Scanner etc.
- Arbeitszimmer / Büroraum: Nur bei (nahezu) ausschließlicher betrieblicher Nutzung sind anteilige Kosten wie Miete oder Strom absetzbar.
- Werkzeuge & Maschinen: Etwa bei Handwerker – z.B. eine Bohrmaschine, die auch zuhause genutzt wird.
Arten der Nutzung und steuerliche Behandlung
Wird etwas betrieblich und privat genutzt, spricht man von gemischter Nutzung. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach dem Ausmaß der Nutzung:
| Nutzung | Steuerliche Behandlung |
|---|---|
| Ausschließlich betrieblich | Volle Betriebsausgabe |
| Ausschließlich privat | Keine Betriebsausgabe – privat zu zahlen |
| Gemischt | Privatanteil muss herausgerechnet werden |

Gemischte Nutzung: Wie wird der Privatanteil ermittelt?
In der Praxis wird der Privatanteil oft geschätzt. Empfehlenswert ist jedoch, die betriebliche Nutzung genau zu dokumentieren – z.B. mit:
- Fahrtenbuch
- Nutzungsprotokoll
- Sonstige Aufzeichnungen
Bei einer Betriebsprüfung muss die Schätzung nachvollziehbar sein. Fehlen Nachweise, darf das Finanzamt den Anteil selbst festlegen – meist zum Nachteil des Unternehmers. Im schlimmsten Fall wird der gesamte betriebliche Anteil gestrichen. Ist keine klare Trennung dokumentiert, gilt die Ausgabe als privat – und ist damit nicht absetzbar.
Typische Schätzwerte aus der Praxis:
- Ausgaben wie Smartphone, Internet oder Büroausstattung werden häufig mit 40 % Privatanteil und 60 % betrieblicher Nutzung angesetzt.
- Diese Werte sind nur grobe Richtwerte und können abweichen.
Beispiel: Ein App-Entwickler nutzt ein Smartphone ausschließlich beruflich für Testzwecke. In diesem Fall kann der betriebliche Anteil auch bei 100 % liegen.
Die genaue Aufteilung zwischen privat und betrieblich sollte immer mit dem Steuerberater besprochen werden – das schützt vor Problemen mit dem Finanzamt.

Umsatzsteuer bei gemischter Nutzung
Wird ein Gerät sowohl betrieblich als auch privat genutzt – z.B. Smartphone, Laptop oder Firmenauto – ist nur der betriebliche Anteil vorsteuerabzugsfähig. Der private Nutzungsanteil ist nicht absetzbar – die darauf entfallende Umsatzsteuer muss anteilig privat gezahlt werden.
Beispiel: Firmenhandy mit 40 % Privatanteil
| Position | Betrag |
|---|---|
| Anschaffungskosten | 500 € netto + 100 € USt. |
| Betriebsausgabe (60 %) | 300 € netto + 60 € abzugsfähige USt. |
| Privatanteil (40 %) | 200 € nicht absetzbar + 40 € USt. zu zahlen |
👉 Nur die 60 % betriebliche Nutzung sind steuerlich absetzbar. Für den privaten Anteil muss Umsatzsteuer gezahlt werden.
Wichtig: Mindestgrenze für den Vorsteuerabzug
Der Vorsteuerabzug ist nur möglich, wenn die betriebliche Nutzung mindestens 10 % beträgt. Liegt sie darunter, entfällt der Abzug in der Regel. Eine Ausnahme gilt bei Arbeitszimmern in der eigenen Wohnung:
Auch wenn der Raum weniger als 10 % der gesamten Wohnfläche ausmacht, ist der Vorsteuerabzug zulässig – vorausgesetzt, der Raum wird ausschließlich betrieblich genutzt. Die übrigen Flächen gelten als privat und sind vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen.
Ausnahme 1: Vorsteuerabzug bei Fahrzeugen
Für normale Pkw und Kombis ist der Vorsteuerabzug in der Regel nicht möglich – selbst bei ausschließlich betrieblicher Nutzung. Mehr dazu im Kapitel Firmenauto: Nutzung, Steuer & Privatanteil.
Ausnahme 2: Umsatzsteuer bei Bewirtungskosten
Bei Bewirtungskosten kann die gesamte Umsatzsteuer als Betriebsausgabe geltend gemacht werden – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Geschäftsessen & Bewirtungskosten: Privatanteil und Umsatzsteuer
Bewirtungskosten – etwa bei Geschäftsessen mit Kunden oder Partnern – gelten als betriebliche Ausgaben, wenn der berufliche Anlass überwiegt. Das heißt: Die Bewirtung muss zu mehr als 50 % beruflich veranlasst sein, z.B. zur Geschäftsanbahnung oder -pflege.
Steuerliche Behandlung von Bewirtungskosten
- Einkommensteuer: 50 % der Netto-Bewirtungskosten sind als Betriebsausgabe abziehbar.
- Umsatzsteuer: 100 % der Umsatzsteuer sind vorsteuerabzugsfähig.
💡 Wichtig: Der berufliche Zweck muss nachgewiesen werden können – eine Restaurantrechnung allein reicht nicht aus (Quelle). Der Unternehmer muss konkret darlegen:
- welches geschäftliche Ziel mit dem Treffen verfolgt wurde und
- dass es sich nicht um ein privates Treffen handelte.
Die Beweislast liegt beim Unternehmer. Fehlen die nötigen Angaben, erkennt das Finanzamt die Kosten nicht an. Folgende Informationen müssen auf oder zur Rechnung ergänzt werden:
- Namen der Teilnehmenden (inkl. Unternehmen und Position)
- Datum des Treffens
- Anlass oder Thema der Besprechung
Bewirtungskosten müssen angemessen sein. Was „angemessen“ ist, hängt vom Einzelfall ab – z.B. Anlass, Branche, Teilnehmerzahl. Feste Betragsgrenzen gibt es nicht, die Entscheidung liegt im Ermessen des Finanzamts.
Steuerliche Behandlung von Trinkgeld
Auch Trinkgeld ist zu 50 % als Betriebsausgabe abziehbar, wenn es eindeutig auf der Rechnung ausgewiesen ist. Trinkgeld, das nicht auf der Rechnung steht, kann steuerlich nicht geltend gemacht werden.

Beispiel: Rechnung von 100 € netto + 20 € USt.
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Bewirtungskosten | 100 € netto + 20 € USt. |
| Betrieblich absetzbar (50 %) | 50 € netto + 20 € USt. (voll abziehbar) |
| Privatanteil (50 %) | 50 € netto (nicht absetzbar) |
👉 Nur der Nettobetrag wird aufgeteilt. Die Umsatzsteuer ist vollständig abziehbar, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Wann sind 100 % absetzbar?
In bestimmten Fällen sind Bewirtungskosten vollständig abzugsfähig – vorausgesetzt, sie dienen nicht der Repräsentation, sondern sind unmittelbarer Teil der Leistung:
- Bewirtung ist Leistungsinhalt
Beispiel: Verpflegung während eines bezahlten Seminars, die im Preis enthalten ist. - Entgeltcharakter
Beispiel: Bewirtung als Vergütung für eine erfolgreiche Vermittlung (z.B. bei freiberuflichen Geschäftsvermittlern). - Keine Repräsentation
Beispiel: Bewirtung im Rahmen einer Betriebsbesichtigung zur Mitarbeitergewinnung.
Kostenlose Snacks oder Getränke für Mitarbeitende im Büro gelten nicht als Bewirtung, sondern als freiwillige Sozialleistung – und sind vollständig absetzbar.

Firmenauto: Nutzung, Steuer & Privatanteil
Wer ein Auto betrieblich nutzt, muss einige steuerliche Regeln beachten. Ob das Fahrzeug zum Betriebsvermögen zählt oder privat genutzt wird, hängt vor allem vom Anteil der betrieblichen Nutzung ab. Eine ausführliche Übersicht mit Rechenbeispielen bietet die Broschüre der WKO (PDF).
Der sogenannte Sachbezug ist nur für Kapitalgesellschaften relevant (z.B. GmbH, FlexKapG, …). Einzelunternehmer sind nicht betroffen – hier wird der Privatanteil einfach anteilig ermittelt.
📒 Tipp: Mit einem lückenlosen Fahrtenbuch weiß man am Jahresende genau, wie die Aufteilung zwischen privat und betrieblich ist.
Wann gehört ein Auto zum Betriebsvermögen?
Ob ein Fahrzeug zum Betriebsvermögen zählt, hängt vom Nutzungsanteil ab:
- Mehr als 50 % betrieblich: Auto zählt als Betriebsvermögen
- Unter 50 % betrieblich: Auto bleibt im Privatvermögen
- Mindestens 10 % betrieblich: Betriebliche Fahrten können anteilig steuerlich berücksichtigt werden.
Grundlage für die Einschätzung ist die Jahreskilometerleistung – idealerweise durch ein lückenlosen Fahrtenbuch belegt. Das ist der beste Nachweis für den betrieblichen Anteil und muss vom Finanzamt im Regelfall auch akzeptiert werden.

Nutzung zwischen 10 % und 50 % – Privatvermögen mit steuerlichen Vorteilen
Wird ein Auto nicht überwiegend, aber mindestens 10 % betrieblich genutzt, kann man zwischen zwei steuerlichen Behandlungsmöglichkeiten wählen:
-
Kilometergeld:
Für jede berufliche Fahrt können pauschal 0,50 € pro Kilometer angesetzt werden (Stand 2026).
Voraussetzung: Die betrieblichen Kilometer dürfen höchstens 50 % der Gesamtkilometerleistung betragen.
Vorteil: Keine Nachweise zu tatsächlichen Kosten nötig – pauschale Abrechnung reicht aus. -
Tatsächliche Kosten anteilig absetzen:
Statt Kilometergeld können die tatsächlichen Kosten wie Treibstoff, Versicherung, Reparaturen, Leasingrate usw. anteilig abgesetzt werden.
👉 Der betriebliche Anteil sollte in beiden Fällen mit einem Fahrtenbuch nachvollziehbar dokumentiert werden.
Am Jahresende lohnt es sich, die Kosten beider Methoden zu vergleichen und die günstigere Variante zu wählen. Für preiswerte Fahrzeuge ist meist das Kilometergeld die einfachere und vorteilhaftere Lösung.

Betriebliche Nutzung über 50 %: Was ist absetzbar?
Wird ein Fahrzeug überwiegend betrieblich genutzt (mehr als 50 %), zählt es zum Betriebsvermögen. Damit sind folgende Kosten steuerlich absetzbar:- Abschreibung (AfA) oder Leasingraten
- Laufende Kosten wie Versicherung, Reparaturen, Treibstoff, Garagenmiete
Privatnutzung herausrechnen
Wird das Fahrzeug auch privat genutzt, muss der Privatanteil vom Gesamtbetrag abgezogen werden. Dabei ist die Luxustangente zu beachten – sie begrenzt die absetzbaren Kosten. Mehr dazu im Kapitel Luxustangente.Die Aufteilung kann geschätzt werden, doch bei einer Betriebsprüfung überprüft das Finanzamt diese Angaben sehr genau. Ein lückenloses Fahrtenbuch ist sicherste Nachweis.
Bei Selbständigen gelten auch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz als betrieblich. Das erhöht den betrieblichen Nutzungsanteil und hilft, Steuern zu sparen.

Umsatzsteuer: Kein Vorsteuerabzug bei Pkw – mit wenigen Ausnahmen
Für normale Pkw und Kombis ist der Vorsteuerabzug grundsätzlich ausgeschlossen – selbst bei 100 % betrieblicher Nutzung. Dazu zählen die meisten Kosten rund um den Pkw, darunter:
- Anschaffungskosten
- Leasingraten
- laufenden Kosten (z.B. Treibstoff, Maut, Reparaturen, Service, Garagenmiete)
Nur in wenigen Sonderfällen ist ein Vorsteuerabzug möglich, zum Beispiel bei bestimmten Fahrzeugtypen wie:
- Fahrschulfahrzeuge
- Vorführfahrzeuge
- Fahrzeuge für den gewerblichen Weiterverkauf (z.B. Kfz-Händler)
- Fahrzeuge mit mindestens 80 % Nutzung für gewerbliche Personenbeförderung (Taxi, Hotelshuttle etc.)
- Elektrofahrzeuge mit 0 g CO₂-Ausstoß (inkl. E-Motorräder, E-Bikes)
👉 Eine detaillierte Liste mit Rechenbeispielen bietet die WKO-Broschüre (PDF).
Bei Elektrofahrzeugen ist aktuell ein voller Vorsteuerabzug möglich – im Gegensatz zu Verbrennern. Wie lange diese Regelung noch gilt, ist unklar – wer davon profitieren will, sollte nicht zu lange warten.
Liegt der Anschaffungspreis eines E-Autos zwischen 40.000 € und 80.000 € kann die volle Vorsteuer zunächst abgezogen werden.
Allerdings muss der Anteil über der Luxustangente, später anteilig wieder ans Finanzamt zurückgezahlt werden. Übersteigt der Preis die Grenze von 80.000 €, entfällt der Vorsteuerabzug zur Gänze.

Luxustangente: Begrenzung der absetzbaren Kosten
Für Fahrzeuge mit Anschaffungskosten über 40.000 € greift die sogenannte Luxustangente: Nur jener Anteil der Kosten, der auf die ersten 40.000 € entfällt, ist steuerlich absetzbar.
- Das Finanzamt stuft Anschaffungskosten oberhalb von 40.000 € als nicht abzugsfähigen „Luxusanteil“ ein. Diese Grenze gilt seit über 20 Jahren und soll laut aktuellem Regierungsprogramm ab 2027/28 angepasst werden.
- Diese Grenze betrifft nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch Versicherung, Reparaturen, Leasingraten, Kreditzinsen und Abschreibungen (Afa). Auch diese Ausgaben sind nur anteilig abziehbar – und zwar im Verhältnis zur 40.000 €-Grenze.
- Ausnahme: Betrieblich veranlasste Tank- und Garagenkosten können unabhängig von der Luxustangente voll abgesetzt werden.
- Wichtig: Auch bei Anwendung der Luxustangente muss ein eventueller Privatanteil zusätzlich herausgerechnet werden.
Anwendung auf Gebrauchtfahrzeuge
Wird ein gebrauchter Pkw innerhalb von 5 Jahren nach Erstzulassung gekauft, gilt für die Luxustangente der ursprüngliche Neupreis inkl. Sonderausstattung. Liegt der Kaufzeitpunkt über 5 Jahre nach der Erstzulassung, wird die Luxustangente auf den tatsächlichen Kaufpreis angewendet.Anwendung auf Leasingfahrzeuge
Auch geleaste Fahrzeuge fallen unter die Luxustangente. Die Leasingraten dürfen nur im Verhältnis zur 40.000 €-Grenze abgesetzt werden. Bei gebrauchten Leasingfahrzeugen gelten dieselben Regeln wie beim Kauf.

Beispielrechnung: 78.000 €-Pkw mit 50 % Privatanteil
Das folgende Beispiel zeigt, wie viel von einem Auto mit einem Bruttowert von 78.000 € steuerlich abgesetzt werden kann – bei einem Privatanteil von 50 % und unter Berücksichtigung der Luxusgrenze.
| Brutto | Netto | Vorsteuer | |
|---|---|---|---|
| Anschaffungswert | 78.000,00 € | 65.000,00 € | 13.000,00 € |
| Luxusanteil, nicht absetzbar | -38.000,00 € | -31.666,67 € | -6.333,33 € |
| Luxusgrenze (max. absetzbar, Fixgrenze) | 40.000,00 € | 33.333,33 € | 6.666,67 € |
| Privatanteil, nicht absetzbar (50 % Netto + volle USt.) | -23.333,33 € | -16.666,66 € | -6.666,67 € |
| Absetzbarer Betrag | 16.666,66 € | 16.666,66 € | 0,00 € |
Nach Anwendung der Luxustangente sind sowohl die Anschaffungskosten als auch laufende Ausgaben wie Reparaturen, Versicherungen oder Wartung nur noch zu 51,28 % steuerlich absetzbar (40.000 € / 78.000 €). Wird zusätzlich der Privatanteil von 50 % berücksichtigt, reduziert sich der absetzbare Anteil noch weiter auf 25,64 % der Gesamtkosten.
Beispielrechnung: 78.000 €-Elektro-Pkw mit 50 % Privatanteil
Bei einem Elektroauto ergibt sich im Vergleich ein kleiner steuerlicher Vorteil: Die Umsatzsteuer kann bis zur Luxustangente von 40.000 € zurückgefordert werden – anders als bei Verbrennern, bei denen der Vorsteuerabzug komplett entfällt.
| Brutto | Netto | Vorsteuer | |
|---|---|---|---|
| Anschaffungswert | 78.000,00 € | 65.000,00 € | 13.000,00 € |
| Luxusanteil, nicht absetzbar | -38.000,00 € | -31.666,67 € | -6.333,33 € |
| Luxusgrenze (max. absetzbar, Fixgrenze) | 40.000,00 € | 33.333,33 € | 6.666,67 € |
| Privatanteil, nicht absetzbar (50 %) | -20.000,00 € | -16.666,67 € | -3.333,34 € |
| Absetzbarer Betrag | 20.000,00 € | 16.666,67 € | 3.333,33 € |
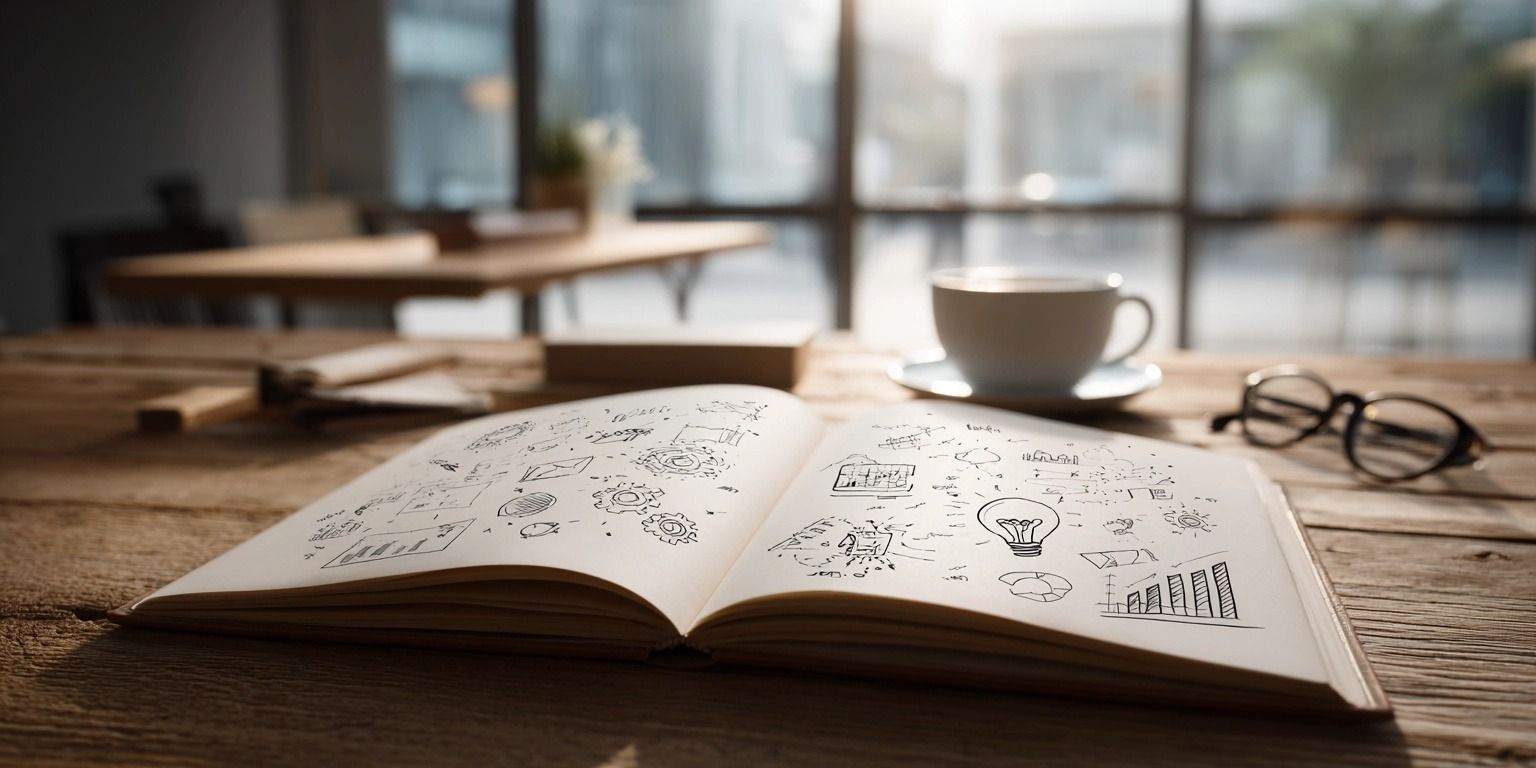
Fazit & Tipps
- Privat bleibt privat
Wird eine betriebliche Anschaffung auch privat genutzt, muss der Privatanteil herausgerechnet werden. Nur der betriebliche Anteil zählt als Betriebsausgabe. - Saubere Nachweise zahlen sich aus
Ein lückenloses Fahrtenbuch, ein ordentlich geführtes Nutzungsprotokoll oder vergleichbare Unterlagen schützen bei einer Betriebsprüfung. Fehlen diese Nachweise, kann das Finanzamt den Privatanteil schätzen – meist nicht im Sinne des Unternehmers. - Umsatzsteuer nur anteilig abziehbar
Die Umsatzsteuer ist nur auf den betrieblichen Anteil abziehbar; für den Privatanteil muss sie privat gezahlt werden. Die betriebliche Nutzung muss mindestens 10 % betragen, sonst entfällt der Vorsteuerabzug komplett. - Bewirtungskosten: Dokumentation ist Pflicht
50 % der Netto-Kosten sind als Betriebsausgabe absetzbar, die Umsatzsteuer sogar zu 100 % – vorausgesetzt, der berufliche Anlass ist klar dokumentiert. Eine Rechnung allein reicht nicht: Es müssen auch Teilnehmer, Datum und Anlass vermerkt sein. - Firmenauto: Dokumentation entscheidet
Ein Fahrtenbuch ist der sicherste Weg zur korrekten Aufteilung. Bei weniger als 50 % betrieblicher Nutzung können Selbständige zwischen Kilometergeld und anteiliger Kostenabrechnung wählen. Und nicht vergessen: Auch Fahrten zum Büro zählen als betrieblich. - Luxustangente im Blick behalten
Bei Fahrzeugen mit Anschaffungskosten über 40.000 € sind nur die anteiligen Kosten bis zu dieser Grenze steuerlich absetzbar – auch bei Leasing oder Gebrauchtwagen. Tank- und Garagenkosten sind eine Ausnahme: Sie bleiben in voller Höhe abzugsfähig. - Elektroautos bringen steuerliche Vorteile
Für E-Fahrzeuge ist ein Vorsteuerabzug möglich – anders als bei herkömmlichen Pkw. Wer investieren will, sollte die aktuellen Regelungen genau beobachten: Die Vorteile sind höchstwahrscheinlich zeitlich befristet.
