Österreich: Abschreibung & Anlagenverzeichnis – Der vollständige Leitfaden
- Michael Leister
- Aktualisiert:
- Unternehmensratgeber
- Buchhaltung & Steuern
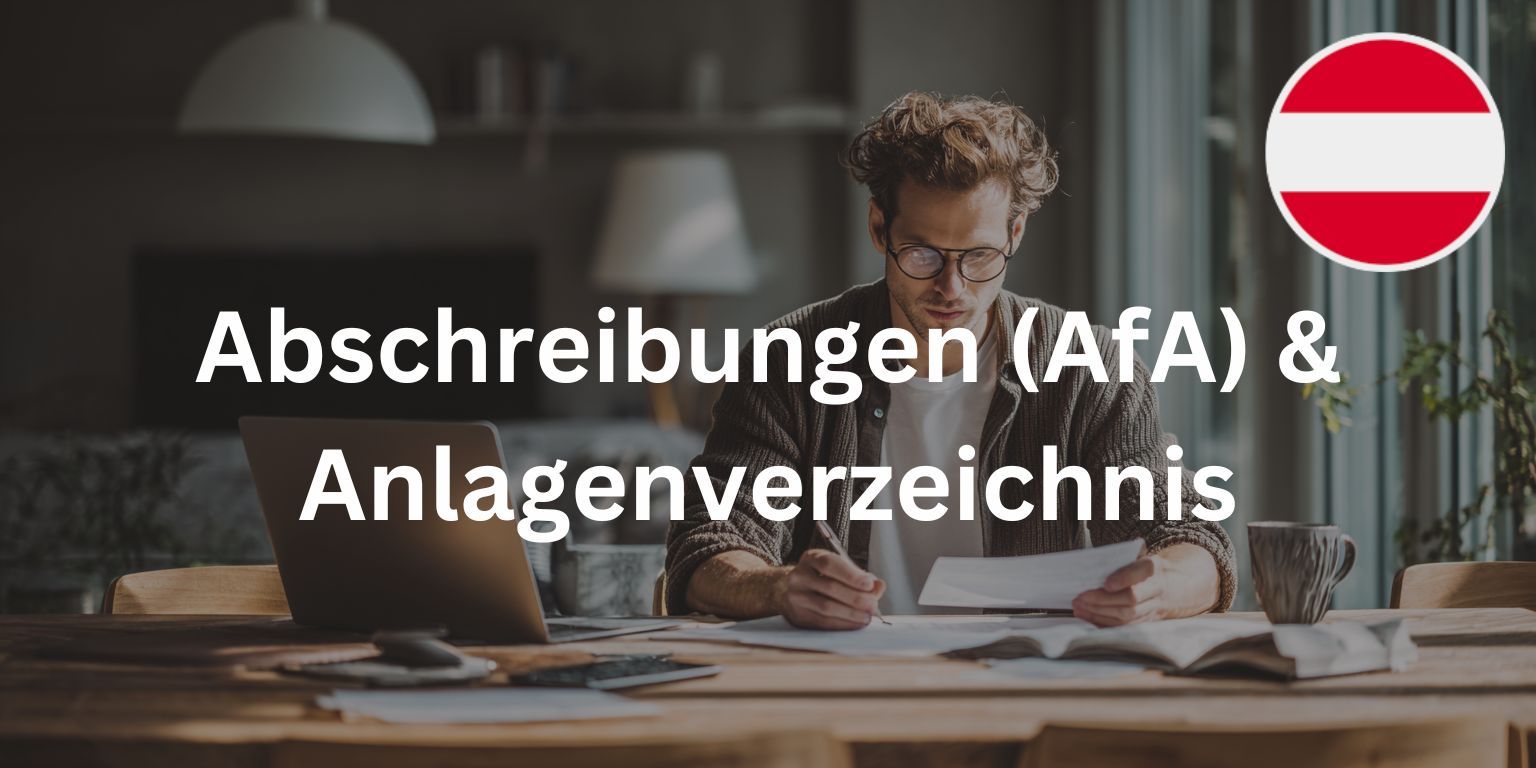
Wenn Sie als Selbständiger oder Einzelunternehmer in Österreich etwas kaufen, das Sie länger als ein Jahr nutzen und das mehr als 1.000 € kostet, dürfen Sie diese Ausgabe nicht sofort vollständig absetzen. Stattdessen verteilen Sie den Wert über die voraussichtliche Nutzungsdauer – das nennt man Abschreibung oder offiziell Absetzung für Abnutzung (AfA).
Einfach gesagt:
Größere Anschaffungen wie Computer, Möbel oder Firmenfahrzeuge können nicht als einmalige Betriebsausgabe abgesetzt werden. Stattdessen werden die Kosten in mehrere Jahresbeträge aufgeteilt und Schritt für Schritt abgeschrieben – so verteilt sich die Ausgabe über die Nutzungsdauer.
Warum Abschreibungen wichtig sind
Steuerlich
Der jährliche Abschreibungsbetrag zählt als Betriebsausgabe und mindert den steuerpflichtigen Gewinn – allerdings über mehrere Jahre und nicht sofort im Anschaffungsjahr.Wirtschaftlich
Jede Anschaffung verliert mit der Zeit an Wert – Computer veralten, Maschinen verschleißen, Fahrzeuge nutzen sich ab. Die AfA bildet diesen tatsächlichen Wertverlust ab und sorgt für eine realistische Bewertung des Anlagevermögens.Kurz erklärt
Die Abschreibung in Österreich stellt sicher, dass länger genutzte Anschaffungen (über 1.000 € und Nutzung über 1 Jahr) nicht sofort, sondern gleichmäßig oder degressiv über mehrere Jahre steuerlich abgesetzt werden.Anschaffungen bis 1.000 € dürfen Sie hingegen sofort im selben Jahr als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vollständig abschreiben – was steuerlich oft die günstigere Variante ist.

Wann muss abgeschrieben werden – und wann nicht?
Abnutzbares vs. nicht abnutzbares Anlagevermögen
Abschreibungen gelten nur für abnutzbare Wirtschaftsgüter – also Gegenstände, die durch Nutzung oder Zeit an Wert verlieren. Dazu zählen zum Beispiel:
- Büroeinrichtung (Schreibtische, Stühle, Regale)
- Computer, Drucker, Scanner
- Fahrzeuge, Maschinen
Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter unterliegen keiner AfA und können daher nicht als laufende Betriebsausgabe erfasst werden.
Typische Beispiele:
- Grundstücke
- Kunstwerke, Antiquitäten
- Wertvolle Teppiche (die nicht am Fußboden aufliegen) oder Sammlerstücke
Der Grund: Diese Güter „verschleißen“ nicht; ihr Wert kann steigen oder fallen, ein planmäßiger Abnutzungsprozess (Wertverlust) liegt nicht vor.
Trotzdem müssen sie im Anlagenverzeichnis erfasst werden, damit bei einem späteren Verkauf die Anschaffungskosten korrekt als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können – allerdings ohne laufende Abschreibungen.
Schwellenwert von 1.000 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)
Investitionen bis 1.000 € netto können als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im selben Jahr vollständig abgeschrieben werden. Für Kleinunternehmer gilt dieser Schwellenwert brutto.
Das heißt: Sie müssen kleine Anschaffungen nicht über mehrere Jahre verteilen, sondern können den vollen Betrag sofort als Betriebsausgabe geltend machen.
Sonderfall: mehrere kleine Posten auf einer Rechnung
Manchmal übersteigt die Gesamtsumme einer Rechnung 1.000 €, die einzelnen Posten liegen jedoch darunter – z.B. bei einer Büroausstattung:
- PC: 800 €
- Monitor: 200 €
- Tastatur: 100 €
In solchen Fällen entscheidet der Einzelposten über die Abschreibung, nicht die Gesamtsumme der Rechnung. Jeder Posten unter 1.000 € kann sofort als geringwertiges Wirtschaftsgut abgeschrieben werden, sofern er einzeln nutzbar ist.
Wenn die einzelnen Posten nur zusammen verwendet werden können – z.B. Hardware-Komponenten, die zu einem Computer zusammengebaut werden – müssen die Beträge zusammengerechnet werden. Überschreiten die Summe die 1.000 € Grenze, so sind die Kosten sind über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Wie berechnet man die Abschreibung?
Die Berechnung der Abschreibung hängt von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes ab. Dabei gilt: Nicht nur der reine Kaufpreis zählt, sondern alle Nebenkosten, die notwendig waren, um das Gut betriebsbereit zu machen.
👉 Zum Abschreibungsrechner für Österreich
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Zur Bemessungsgrundlage gehören unter anderem:
- Kaufpreis des Wirtschaftsgutes
- Transport- und Lieferkosten
- Zölle, Vermittlungsprovisionen
- Montage- oder Installationskosten
- Anwalts- oder Notargebühren
- Grunderwerbsteuer (bei Grundstücken oder Gebäuden)
- Fundamentierungs- oder Sonderaufwendungen für die Inbetriebnahme
Derartige Aufwendungen müssen zum Einkaufspreis dazu gerechnet werden. Sie erhöhen die Anschaffungskosten und sind Teil der Abschreibungsbasis.
Auch selbst hergestellte Güter müssen abgeschrieben werden. Hier zählen Materialkosten, Fertigungslöhne, Gemeinkosten und Sonderkosten der Fertigung zur Bemessungsgrundlage.
Netto oder Brutto – abhängig vom Umsatzsteuerstatus
- Regelbesteuerung: Die AfA wird auf die Netto-Anschaffungskosten berechnet. Die Vorsteuer können Sie im Jahr der Anschaffung vollständig geltend machen und mit der Umsatzsteuer verrechnen.
- Kleinunternehmerregelung: Hier werden die Beträge brutto erfasst, da kein Vorsteuerabzug möglich ist.
Praxisbeispiel
Sie richten Ihr Büro neu ein und kaufen ein Computernetzwerk um 4.000 €. Zusätzlich fallen Nebenkosten an, damit das System vollständig betriebsbereit ist:
- Elektroinstallateur: 500 €
- Montagekosten: 200 €
- Lieferkosten: 100 €
Berechnung der AfA-Bemessungsgrundlage:
Anschaffungskosten = 4.000 € + 500 € + 200 € + 100 € = 4.800 €
Die gesamten 4.800 € bilden somit die Grundlage für die jährliche Abschreibung Ihres Wirtschaftsgutes – entweder linear oder degressiv, abhängig von der gewählten Methode.
Damit ist klar: Zur richtigen AfA-Berechnung zählen alle Anschaffungs- und Nebenkosten, und auch der Umsatzsteuerstatus (Vorsteuerabzug oder nicht) muss berücksichtigt werden.

Methoden der Abschreibung in Österreich
Die AfA (Absetzung für Abnutzung) beschreibt die planmäßige Wertminderung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern über die Zeit. In Österreich kommen im Wesentlichen drei Methoden zur Anwendung, wobei hauptsächlich zwei davon relevant sind:
- Lineare AfA
- Degressive AfA
- Beschleunigte AfA (nur für Gebäude)
Der AfA-Betrag kann wie eine Ausgabe betrachtet werden – mit dem Unterschied, dass er nur einen Teil der tatsächlichen Anschaffungskosten abbildet und jährlich wiederkehrt, bis die gesamten Anschaffungskosten abgeschrieben sind.
Lineare Abschreibung (Standardmethode)
Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs-/Herstellungskosten gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt.
Vorteile
- Einfache Berechnung
- Gleichmäßige Belastung des Gewinns über die Nutzungsdauer
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer muss in Österreich in der Regel geschätzt werden (mehr dazu im Abschnitt Nutzungsdauer).
Beispiel der linearen Abschreibung
Eine Büroeinrichtung kostet 20.000 €. Das Unternehmen schätzt eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.
- Jährliche Abschreibung: 20.000 € ÷ 10 Jahre = 2.000 €
- Nach 10 Jahren ist die Büroeinrichtung vollständig abgeschrieben.
- Wird sie länger genutzt, bleibt sie weiterhin im Anlagenverzeichnis, ohne weitere Abschreibungen.
| Jahr | Restwert Jahresbeginn | Abschreibung | Restwert Jahresende |
|---|---|---|---|
| 1. | 20.000,00 € | 2.000,00 € | 18.000,00 € |
| 2. | 18.000,00 € | 2.000,00 € | 16.000,00 € |
| 3. | 16.000,00 € | 2.000,00 € | 14.000,00 € |
| ... | ... | ... | ... |
| 9. | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 10. | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |

Degressive Abschreibung
Die degressive AfA ist eine Alternative zur linearen Abschreibung und ermöglicht in den ersten Jahren der Nutzung höhere Abschreibungsbeträge. Unternehmen können im ersten Wirtschaftsjahr entscheiden, welche Methode sie wählen möchten.
Die wichtigsten Punkte
Die degressive AfA kann nur für bestimmte Wirtschaftsgüter angewendet werden. Wie bei der linearen Abschreibung erfolgt die Berechnung auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Der Abschreibungssatz beträgt bis zu 30 % des Restwertes pro Jahr und kann frei gewählt werden; in der Praxis wird meist der volle Satz von 30 % verwendet. Dieser Prozentsatz bleibt über die gesamte Nutzungsdauer konstant.
Der Vorteil der degressiven AfA liegt darin, dass die Abschreibungsbeträge zu Beginn höher ausfallen und im Laufe der Zeit abnehmen. Ob dies für Ihr Unternehmen tatsächlich ein Vorteil ist, hängt von der jeweiligen Situation ab.
Ein Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibung ist mit Beginn eines Wirtschaftsjahres möglich. Umgekehrt, also von linear zu degressiv, ist ein Wechsel nicht zulässig. Beim Wechsel wird der Restbuchwert als Ausgangsbasis genommen, also die Anschaffungskosten abzüglich aller bisher vorgenommenen Abschreibungen.
Um die maximale Abschreibung zu erzielen, ist es sinnvoll, nach einigen Jahren von der degressiven auf die lineare AfA umzusteigen. Nämlich dann, wenn der lineare Jahresbetrag höher ist als der degressive Jahresbetrag. Durch die Umstellung kann die Abschreibung erhöht werden.
Beispiel der degressiven Abschreibung
Anschaffung einer Büroeinrichtung für 20.000 €
- Geschätzte Nutzungsdauer: 10 Jahre
- Degressiver Abschreibungssatz: 30 %
| Jahr | Restwert Jahresbeginn | Abschreibung | Restwert Jahresende |
|---|---|---|---|
| 1. | 20.000,00 € | 6.000,00 € | 14.000,00 € |
| 2. | 14.000,00 € | 4.200,00 € | 9.800,00 € |
| 3. | 9.800,00 € | 2.940,00 € | 6.860,00 € |
| ... | ... | ... | ... |
| 9. | 1.152,96 € | 345,89 € | 807,07 € |
| 10. | 807,07 € | 807,07 € | 0,00 € |
Die Beträge sinken jedes Jahr, bis die geschätzte Nutzungsdauer erreicht ist. Im letzten Jahr kann der verbleibende Restbuchwert vollständig abgeschrieben werden. Die degressive AfA ist ausgeschlossen für:
- Wirtschaftsgüter mit gesetzlicher Sonderform der AfA (siehe gesetzliche Nutzungsdauer)
- Gebrauchte Wirtschaftsgüter
- Immaterielle Wirtschaftsgüter (mit Ausnahmen: Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit/Life-Science)
- Weitere Details und Ausnahmen
Elektroautos dürfen derzeit degressiv abgeschrieben werden.
Beispiel der degressiven Abschreibung mit Wechsel zur linearen Abschreibung
| Jahr | Restwert Jahresbeginn | Abschreibung | Restwert Jahresende |
|---|---|---|---|
| 1. | 20.000,00 € | 6.000,00 € | 14.000,00 € |
| 2. | 14.000,00 € | 4.200,00 € | 9.800,00 € |
| 3. | 9.800,00 € | 2.940,00 € | 6.860,00 € |
| 4. | 6.860,00 € | 2.058,00 € | 4.802,00 € |
| 5. | 4.802,00 € | 1.440,60 € | 3.361,40 € |
| 6. | 3.361,40 € | 1.008,42 € | 2.352,98 € |
| 7. | 2.352,98 € | 705,89 € | 1.647,09 € |
| 👉 Wechsel von degressiver zu linearer Abschreibung. | |||
| 8. | 1.647,09 € | 549,03 € | 1.098,06 € |
| 9. | 1.098,06 € | 549,03 € | 549,03 € |
| 10. | 549,03 € | 549,03 € | 0,00 € |

Beschleunigte AfA
Die beschleunigte AfA ist ausschließlich für Gebäude anwendbar. Sie ermöglicht es, zu Beginn der Nutzung höhere Abschreibungsbeträge geltend zu machen, sodass Investitionen schneller steuerlich wirksam werden. Weitere Details
Halbjahresabschreibung
Für die korrekte Berechnung der AfA ist nicht der Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entscheidend, sondern der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes. Das bedeutet: Wann das Anlagegut tatsächlich genutzt wird, bestimmt, ob die Ganzjahres- oder Halbjahres-AfA zum Einsatz kommt.
Grundprinzip
- Ganzjahresabschreibung: Wird ein Wirtschaftsgut im ersten Halbjahr eines Jahres (vor dem 1. Juli) in Betrieb genommen, kann der volle Jahresbetrag abgeschrieben werden.
- Halbjahresabschreibung: Erfolgt die Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr (ab 1. Juli), darf nur die Hälfte des Jahresbetrags als Abschreibung angesetzt werden.
Das gleiche Prinzip gilt auch beim Ausscheiden eines Wirtschaftsgutes. Scheidet das Anlagegut im ersten Halbjahr aus, kann nur die Halbjahres-AfA angesetzt werden; bei Ausscheiden im zweiten Halbjahr gilt die Ganzjahres-AfA.
Beispiel
Ihr Unternehmen kauft am 30. Oktober 2026 eine Maschine für 10.000 €. Die Maschine wird sofort für die Produktion eingesetzt, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Bei der linearen Abschreibung beträgt der jährliche AfA-Betrag 2.000 €.
Da die Maschine im zweiten Halbjahr in Betrieb genommen wurde, steht für das Jahr 2026 nur die Halbjahres-AfA von 1.000 € zu. Erst ab dem Jahr 2027 kann der volle Jahresbetrag von 2.000 € abgeschrieben werden. Dadurch verlängert sich die Abschreibungsdauer um ein (halbes Wirtschafts-) Jahr, sodass im letzten Jahr erneut nur der halbe Betrag anfällt.
Wichtig: Vergessene Abschreibungen dürfen in späteren Jahren nicht nachgeholt werden. Es ist also entscheidend, die Inbetriebnahme zu dokumentieren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind Anlagegüter, deren Anschaffungskosten unter 1.000 € netto liegen – bei Kleinunternehmern gilt der Betrag brutto. Typische Beispiele sind Schreibtische, Schreibtischstühle, Kleinmöbel, beruflich genutzte Software, Laptops oder Smartphones.
Der besondere Vorteil von GWG liegt darin, dass Sie die Anschaffungskosten sofort und in voller Höhe als Betriebsausgabe geltend machen können. Sie sparen sich damit die langwierige, stückweise Abschreibung über mehrere Jahre und die aufwändige Erfassung im Anlagenverzeichnis.
Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
- Sofortabschreibung: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung vollständig als Betriebsausgabe erfasst.
- Klassische AfA: Sie können das GWG auch in das Anlagenverzeichnis aufnehmen und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben.
Wann welche Variante sinnvoll ist
Die Wahl zwischen Sofortabschreibung und klassischer AfA hängt von Ihrer individuellen Gewinn- und Steuerplanung ab:
- Die Sofortabschreibung lohnt sich, wenn Sie kurzfristig Ihre Steuerlast reduzieren möchten.
- Die Klassische AfA ist sinnvoll, wenn Sie in einem Jahr geringe Einnahmen haben und die Betriebsausgaben lieber auf die kommenden Jahre verteilen wollen, um den steuerlichen Effekt zu optimieren.

Nutzungsdauer richtig schätzen
Die Nutzungsdauer bestimmt, über welchen Zeitraum ein Wirtschaftsgut abgeschrieben wird – und ist damit die zentrale Grundlage jeder AfA-Berechnung. In Österreich gibt es keine festen gesetzlichen Regeln für die Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern. Unternehmen müssen die Nutzungsdauer selbst realistisch schätzen, basierend auf der tatsächlichen betrieblichen Nutzung.
Gesetzliche Vorgaben vs. Erfahrungswerte
Nur in wenigen Fällen ist sie gesetzlich geregelt, etwa bei:
- Gebäuden zu Wohnzwecken: 67 Jahre
- Firmenwerten bei land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben: 15 Jahre
- PKW und Kombis: mindestens 8 Jahre (Ausnahme: Fahrschulfahrzeuge, Taxis, Klein-Lkw und Kleinbusse)
Für alle anderen Wirtschaftsgüter muss die Nutzungsdauer individuell geschätzt werden. Maßgeblich ist nicht die technische Lebensdauer, sondern die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer – also die Zeitspanne, in der das Wirtschaftsgut im Betrieb voraussichtlich genutzt wird.
Ein Beispiel: Wenn in einem Betrieb erfahrungsgemäß jede Bohrmaschine nach drei Jahren ausgetauscht werden muss, ist eine Schätzung von drei Jahren realistischer als der theoretische Richtwert von zehn Jahren.
Dieselbe Maschine kann in einem Einschichtbetrieb eine deutlich längere Nutzungsdauer haben als in einem Mehrschichtbetrieb. Entscheidend ist, wie stark sie tatsächlich beansprucht wird.
Gesetzliche Vorgaben vs. Erfahrungswerte
In Österreich gibt es – anders als in Deutschland – keine verbindlichen AfA-Tabellen, an die Sie sich halten müssen. Nur für wenige Wirtschaftsgüter (z.B. Gebäude, PKW, Firmenwert) ist die Nutzungsdauer gesetzlich festgelegt. Für alle anderen Güter müssen Unternehmer selbst eine realistische Schätzung vornehmen.
Die Schätzung sollte nachvollziehbar und dokumentiert sein – etwa durch Erfahrungswerte aus dem eigenen Betrieb, Wartungsprotokolle oder Vergleichswerte aus der Branche. Das Finanzamt akzeptiert individuelle Schätzungen, sofern sie sachlich begründet sind.
So gehen Sie dabei vor:
- Prüfen Sie, ob eine gesetzliche Regelung besteht
- Verwenden Sie Ihre eigenen Erfahrungswerte:
Ziehen Sie die tatsächliche Nutzung in Ihrem Betrieb heran. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Geräte oder Maschinen üblicherweise nach drei Jahren ersetzt werden, darf diese Nutzungsdauer auch angesetzt werden. - Nutzen Sie Richtwerte aus österreichischen AfA-Tabellen:
Für viele Anlagegüter existieren branchenübliche Erfahrungswerte. Diese finden Sie in inoffiziellen AfA-Tabellen oder bei Steuerberatern. Sie dienen als Orientierung, sind aber nicht verbindlich. - Blicken Sie ergänzend in die deutschen AfA-Tabellen:
Die amtlichen AfA-Tabellen aus Deutschland können zusätzliche Hinweise liefern, wenn es in Österreich keine gängigen Erfahrungswerte gibt. Sie sind allerdings rein informativ und haben keinen Rechtsanspruch in Österreich.
Praxisbeispiel: Gebrauchtfahrzeug
Wenn Sie ein gebrauchtes Wirtschaftsgut erwerben, können Sie die bereits abgelaufene Nutzungsdauer vom ursprünglich vorgesehenen Zeitraum abziehen.
Beispiel: Die gewöhnliche Nutzungsdauer eines PKW beträgt acht Jahre. Kaufen Sie ein Fahrzeug, das bereits zwei Jahre im Einsatz war, beträgt die verbleibende Nutzungsdauer sechs Jahre.
👉 In diesem Fall können Sie den Kaufpreis gleichmäßig über die nächsten sechs Jahre abschreiben. Vorsicht: Luxustangente und Privatanteil beachten
Dasselbe Prinzip gilt auch für alle anderen gebrauchten Wirtschaftsgüter – etwa Maschinen, Büroausstattung oder Computertechnik. Entscheidend ist immer, wie viele Jahre das Gut voraussichtlich noch im Unternehmen genutzt werden kann.
Typische Richtwerte (AfA-Tabelle Österreich)
Die folgende Übersicht zeigt gängige Richtwerte für die Abschreibungsdauer. Je nach Branche, Nutzungshäufigkeit oder technologischem Fortschritt können diese angepasst werden.
| Wirtschaftsgut | Übliche Nutzungsdauer |
|---|---|
| PKW, Kombis Es gelten Ausnahmen für Fahrschulen, Taxis, Klein-LKW und Kleinbusse. | 8 Jahre gesetzlich festgelegt |
| Firmenwert bei land- und forstwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben | 15 Jahre gesetzlich festgelegt |
| Betriebsgebäude | 40 Jahre gesetzlich festgelegt |
| Gebäude (Wohnzwecke) | 67 Jahre gesetzlich festgelegt |
| PC, Laptop, Drucker, Scanner, Bildschirme etc. | 3 Jahre |
| Telefon, Smartphone | 3 Jahre |
| Software & Homepage | 3 Jahre |
| LKW | 5 Jahre |
| Firmenwert (freiberuflich) | 5 Jahre |
| Registrierkasse | 6 Jahre |
| E-Fahrräder | 7 Jahre |
| Foto-, Film-, Audio- & Videogeräte | 7 Jahre |
| Werkzeuge (mobil, z.B. Bohrmaschinen, Presslufthämmer) | 8 Jahre |
| EC-Kartenleser, Kreditkartenleser | 8 Jahre |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10 Jahre |
| Büromöbel | 13 Jahre |
| Maschinen | 13 Jahre |
Unterschied zu deutschen AfA-Tabellen
In Deutschland gibt es amtliche AfA-Tabellen, die vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht werden und für Betriebsprüfungen verbindliche Orientierung bieten. In Österreich hingegen dienen solche Tabellen nur als unverbindliche Richtlinie. Unternehmen müssen die Nutzungsdauer immer individuell begründen und gegebenenfalls abweichend von deutschen Tabellen anpassen.

Nachträgliche Änderungen der AfA
Im Unternehmensalltag läuft nicht immer alles nach Plan – manchmal ändern sich Anschaffungswerte, Nutzungsdauern oder Anlagen scheiden früher aus als gedacht. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, wie Sie mit bereits laufenden Abschreibungen umgehen.
Korrektur des Anschaffungswerts
Grundsätzlich gilt: Sobald die erste Abschreibung erfolgt ist, sind die Anlagedaten fix. Nachträgliche Änderungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. Dazu zählen:
- Fehlerhafte Eingaben (z.B. falscher Betrag oder Anschaffungszeitpunkt),
- vergessene oder nachträglich angefallene Aufwendungen, die eigentlich zu den Anschaffungskosten gehören (z.B. Transport-, Montage- oder Notarkosten),
- oder nachträgliche Investitionen, die eindeutig als Bestandteil des bestehenden Wirtschaftsguts zu sehen sind.
In solchen Fällen wird der Anschaffungswert korrigiert, und der AfA-Plan neu berechnet. Frühere Jahre bleiben jedoch unverändert – die Anpassung gilt nur ab dem laufenden Jahr (= die AfA darf nicht nachgeholt werden).
Dokumentieren Sie die Korrektur gut – idealerweise mit Belegen oder einer kurzen Notiz in Ihrem Anlagenverzeichnis. So vermeiden Sie Rückfragen des Finanzamts.
Änderung der Nutzungsdauer
Manchmal zeigt sich erst im laufenden Betrieb, dass ein Wirtschaftsgut länger oder kürzer genutzt werden kann als ursprünglich angenommen. Auch dann darf die AfA angepasst werden – ebenfalls nur mit nachvollziehbarer Begründung.
Typische Gründe für eine Verkürzung der Nutzungsdauer:
- Stärkere Beanspruchung als erwartet (z.B. Mehrschichtbetrieb)
- Technologische Überalterung (z.B. durch neue Gerätegeneration)
- außergewöhnliche Abnutzung (z.B. Defekt oder Schaden)
Wird hingegen klar, dass eine Anlage länger nutzbar ist, darf die Nutzungsdauer verlängert werden – etwa wenn Maschinen regelmäßig gewartet und instand gehalten werden.
Nach einer Änderung muss der Abschreibungsplan ab dem aktuellen Wirtschaftsjahr neu berechnet werden. Bereits abgeschlossene Jahre bleiben unverändert.
Außergewöhnliche Abnutzung
Eine außergewöhnliche Abnutzung (AfA) liegt vor, wenn ein Wirtschaftsgut plötzlich und unvorhersehbar stark an Wert verliert – zum Beispiel durch:
- einen technischen Defekt oder Unfall,
- eine Naturkatastrophe,
- Zerstörung oder Diebstahl,
- oder eine wirtschaftliche Entwertung (z.B. durch eine plötzliche Marktveränderung oder ein neues Konkurrenzprodukt).
In solchen Fällen darf der Restbuchwert sofort vollständig abgeschrieben werden.
Eine reine Preisänderung oder ein Rückgang der Nachfrage gilt nicht als außergewöhnliche Abnutzung. Die Abwertung muss objektiv nachvollziehbar und nachweisbar sein – etwa durch Fotos, Gutachten oder Reparaturrechnungen.

Ausscheiden eines Wirtschaftsguts
Wenn ein Anlagegut verkauft, zerstört oder privat entnommen wird, scheidet es aus dem Betriebsvermögen aus. Damit endet auch die AfA.
Je nach Art des Ausscheidens gelten unterschiedliche steuerliche Folgen:
- Verkauf: Wird ein Anlagegut verkauft, entstehen gleichzeitig Einnahmen und Ausgaben. Der Restbuchwert wird als Betriebsausgabe unter der E1a-Kennzahl 9210 („Buchwert abgegangener Anlagegüter“) erfasst. Der Verkaufserlös ist eine Betriebseinnahme unter der Kennzahl 9060 („Erlös abgegangener Anlagegüter“). Die Differenz zwischen Erlös und Restbuchwert ergibt den Gewinn oder Verlust aus dem Anlagenverkauf. Dieser ist steuerpflichtig und erhöht bzw. vermindert das steuerliche Ergebnis.
- Zerstörung oder Verlust: Wird ein Wirtschaftsgut zerstört oder gestohlen, darf der volle Restbuchwert sofort abgeschrieben werden. Die Buchung erfolgt unter der E1a-Kennzahl 9130, je nach Erfassungssystem. Ein allfälliger Versicherungsersatz ist als Einnahme zu verbuchen.
Dokumentieren Sie jede Ausscheidung sorgfältig – etwa mit Entsorgungsschein, Fotos oder Kaufverträgen. Nur so können Sie im Fall einer Prüfung nachweisen, dass die Anlage tatsächlich aus dem Betrieb ausgeschieden ist.
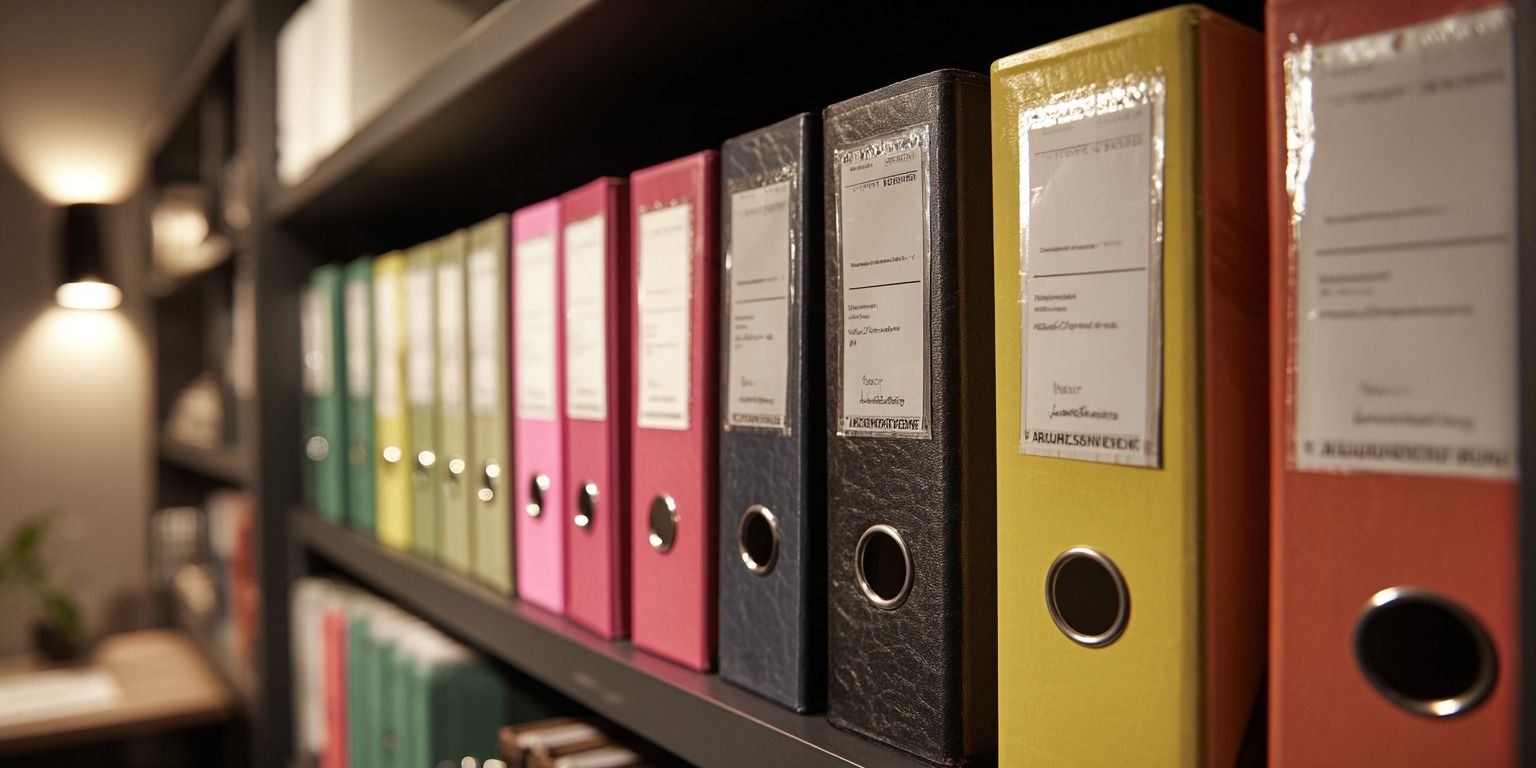
Das Anlagenverzeichnis (AVZ)
Das Anlagenverzeichnis (AVZ) ist ein zentrales Instrument der Buchführung. Es zeigt übersichtlich, welche Anlagegüter sich im Betriebsvermögen befinden, wie hoch deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten waren und welche Abschreibungen (AfA) bereits vorgenommen wurden.
Das Verzeichnis ist gesetzlich vorgeschrieben und dient sowohl der Nachvollziehbarkeit gegenüber dem Finanzamt als auch der internen Übersicht über den aktuellen Stand des Betriebsvermögens.
Umsatzsteuerregelung:
- Unternehmer mit Vorsteuerabzug können die gezahlte Umsatzsteuer sofort in voller Höhe als Vorsteuer geltend machen. Das bedeutet, die Umsatzsteuer fließt nicht „nach und nach“ über die Abschreibung zurück, sondern wird im selben Jahr, in dem das Wirtschaftsgut gekauft wurde, vom Finanzamt zurückerstattet. Aus diesem Grund wird das AVZ netto geführt – die Umsatzsteuer ist bereits separat abgegolten.
- Kleinunternehmer erfassen die Anlage brutto, da die Umsatzsteuer für sie Bestandteil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist. Sie können die Umsatzsteuer nicht separat geltend machen, daher wird sie in die AfA-Berechnung einbezogen.
Warum ist ein AVZ Pflicht?
Unternehmer müssen alle abnutzbaren Wirtschaftsgüter (mit Ausnahme von geringwertigen Wirtschaftsgütern, GWG) über ihre Nutzungsdauer abschreiben. Das AVZ stellt sicher, dass diese AfA-Beträge nachvollziehbar und korrekt erfasst werden.
Anlagenverzeichnis: Aufbau und Inhalte
Ein ordnungsgemäßes Anlagenverzeichnis enthält alle wesentlichen Angaben, die das jeweilige Wirtschaftsgut eindeutig identifizierbar machen. Folgende Punkte müssen zwingend enthalten sein:
- Genaue Bezeichnung des Wirtschaftsguts (z.B. „Laptop Apple MacBook Pro 14 Zoll“ oder „Büromöbel – Schreibtisch Holz massiv“)
- Anschaffungs- oder Herstellungsdatum: Maßgeblich ist der Tag der Anschaffung oder Inbetriebnahme, nicht das Zahlungsdatum.
- Anschaffungs- oder Herstellungskosten: Inklusive aller Nebenkosten wie Transport, Zölle, Montage, Notar- oder Vermittlungskosten.
- Lieferant oder Verkäufer: Name und Anschrift
- Voraussichtliche Nutzungsdauer in Jahren
- Jährlicher AfA-Betrag
- Restbuchwert zum 31.12.: Entspricht Anschaffungs- oder Herstellungskosten minus bisherige Abschreibungen (der noch absetzbare Betrag).
Das Ausscheiden eines Anlageguts (z.B. durch Verkauf, Zerstörung oder Entnahme) sollte immer nachvollziehbar dokumentiert werden – etwa durch Entsorgungsnachweise, Fotos oder Verkaufsbelege. Nur so kann das Finanzamt den Abgang des Wirtschaftsguts eindeutig nachvollziehen.
Wann und wie die Eintragung erfolgen muss
Das Anlagenverzeichnis muss nicht sofort beim Kauf geführt werden. Es reicht aus, wenn es zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung vollständig und korrekt ist.
Es ist ausreichend, wenn das Verzeichnis im Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung ordnungsgemäß geführt ist.
— EStR 2000, Rz 3136
Das Verzeichnis wird nicht automatisch ans Finanzamt übermittelt, kann aber bei Betriebsprüfungen angefordert werden. Es empfiehlt sich, das AVZ laufend zu pflegen – digital (Buchhaltungssoftware) oder in Excel – damit alle Werte jederzeit abrufbar sind.
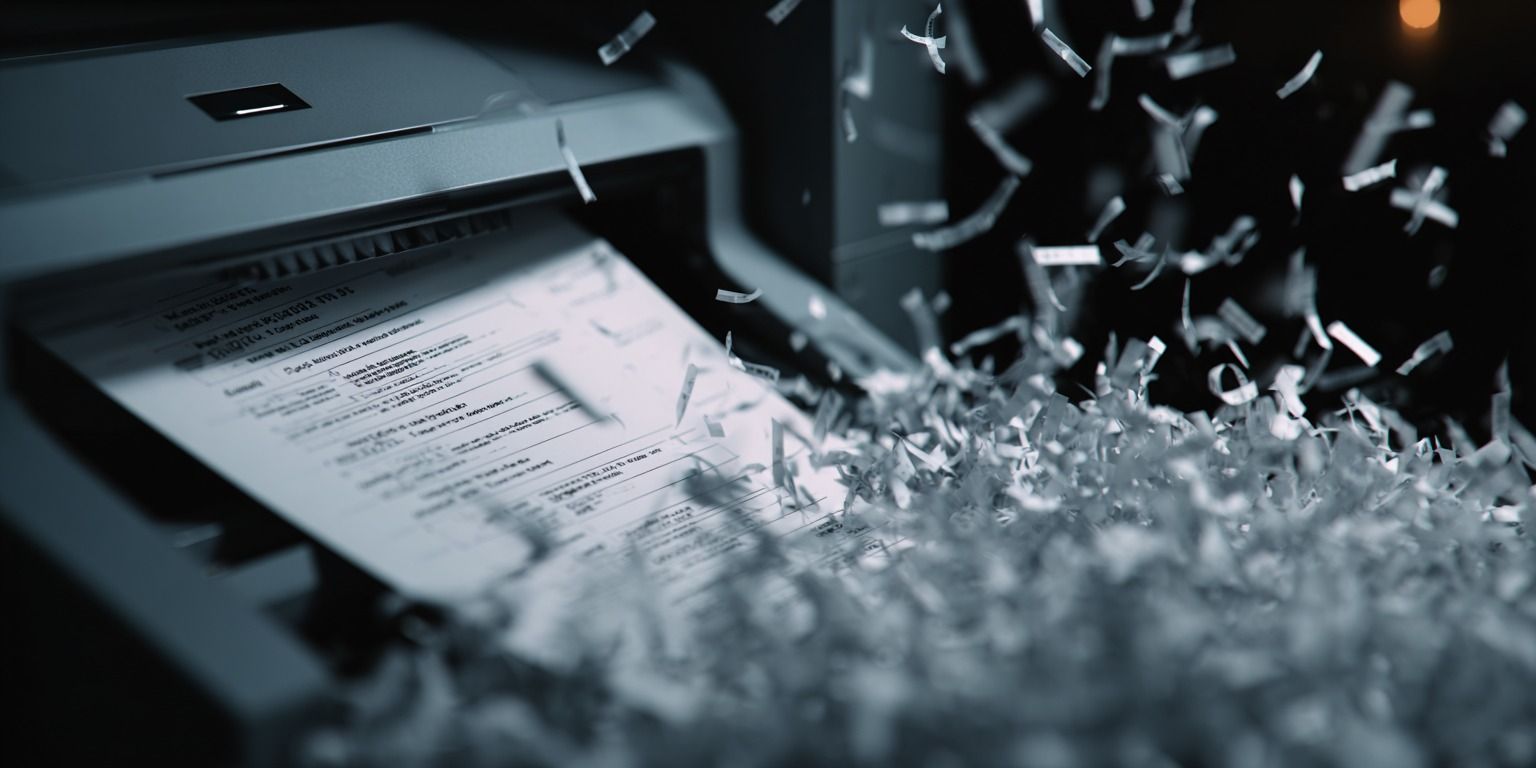
Behandlung vollständig abgeschriebener oder ausgeschiedener Anlagen
Ist ein Wirtschaftsgut vollständig abgeschrieben, bleibt es im Anlagenverzeichnis, solange es im Betrieb weiterhin genutzt wird – manchmal mit einem symbolischen Restwert von 0,01 € (Erinnerungscent). So bleibt das Anlagegut sichtbar und nachvollziehbar erfasst.
Scheidet ein Wirtschaftsgut jedoch tatsächlich aus dem Betrieb aus – etwa durch Verkauf, Entsorgung, Diebstahl oder private Entnahme –, wird es aus dem Anlagenverzeichnis entfernt und entsprechend dokumentiert.
Beispiel: Nicht abnutzbares Wirtschaftsgut (Domain)
Nicht nur abnutzbare, sondern auch nicht abnutzbare Anlagegüter müssen im AVZ aufscheinen. Dazu zählen etwa Grundstücke, Beteiligungen oder Domains.
Beispiel: Ein Unternehmer kauft die Domain kalkuel.at um 1.500 € von einem Vorbesitzer. Da eine Domain nicht abnutzbar ist, erfolgt keine Abschreibung. Sie wird im Anlagenverzeichnis mit unbegrenzter Nutzungsdauer und einem Restbuchwert von 1.500 € geführt.
Wird die Domain später verkauft:
- Die 1.500 € Anschaffungskosten werden als Betriebsausgabe gebucht.
- Der Verkaufserlös als Betriebseinnahme.
Laufende Domain-Registrierungskosten dürfen hingegen jährlich als Betriebsausgabe abgesetzt werden.
